Die Haftung von Bergführern im alpinen Raum
Autor: RA Andreas Ermacora
In Österreich gibt es nur ganz wenige gesetzliche Regelungen, die sich mit dem Alpinsport beschäftigen. Das Bergsportführerwesen ist in diversen Landesgesetzen geregelt. Deshalb kommt den allgemein anerkannten Verhaltensregeln, Standards oder Verkehrsnormen besondere Bedeutung zu.
Wer sich mit alpinrechtlichen Fällen befasst, wird bald feststellen, dass es kaum gesetzliche Regelungen gibt. Die in den Bergsportführergesetzen normierten Bestimmungen sind sehr allgemein gehalten, sodass die Frage eines Sorgfaltsverstoßes zumeist im Einzelfall und unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Verhaltensregeln zu beurteilen ist. Die Pflichten der Berg- und Skiführer sind aufgrund der Vielzahl der Gesetze unterschiedlich geregelt. So führt § 8 des Tiroler Bergsportführergesetzes aus, dass ein Berg- und Skiführer bei der Ausübung seiner Tätigkeit dafür zu sorgen hat, dass die körperliche Sicherheit seiner Gäste nicht gefährdet wird, dass er sich vor dem Antritt einer Berg- oder Skitour davon zu überzeugen hat, dass seine Gäste ausreichend ausgerüstet sind, und er die Führung von Personen abzulehnen hat, die mangelhaft ausgerüstet oder den Schwierigkeiten der geplanten Berg- oder Skitour offensichtlich nicht gewachsen sind. Ein Berg- und Skiführer hat die Höchstzahl der zu führenden Personen unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit und der Schwierigkeit der geplanten Berg- oder Skitour so festzusetzen, dass die körperliche Sicherheit seiner Gäste gewährleistet ist. Wenn Umstände eintreten, bei denen die körperliche Sicherheit seiner Gäste gefährdet scheint, hat er eine Berg- oder Skitour abzubrechen. Er darf seine Gäste im alpinen Gelände nur dann alleine lassen, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um Hilfe herbeizuholen. In einem solchen Fall hat er für die Sicherheit der Zurückbleibenden bestmöglich zu sorgen.
Im Salzburger Bergsportführergesetz findet sich unter anderem die Bestimmung, dass der Bergsportführer seine Gäste über Gefahren und Risiken der geplanten Unternehmung aufzuklären hat.
Anders als zB in der StVO ist in den Bergsportführergesetzen aber nicht geregelt, welche Verhaltensmaßnahmen im Einzelnen einzuhalten sind. In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass man bei Rot stehen bleiben muss, dass der von rechts Kommende Vorrang hat oder dass eine gewisse Geschwindigkeit einzuhalten ist. Hingegen ist in den Bergsportführergesetzen nicht geregelt, welche Hänge in welcher Steilheit bei welcher Lawinenstufe nicht befahren werden dürfen, ab welcher Steilheit im Aufstieg Abstände einzuhalten sind oder welche Sicherungsmaßnahmen beim Besteigen von Felswänden vorliegen müssen. Wenn also gesetzliche Regelungen im Detail fehlen und ein Sachverhalt nicht unter die doch sehr allgemein gehaltenen Bestimmungen der Bergsportführergesetze zu subsumieren ist, stützt sich die Rechtsprechung bei der rechtlichen Beurteilung eines Alpinunfalles auf Verkehrsnormen oder allgemein anerkannte Verhaltensregeln, sofern solche vorhanden sind. Darunter werden jene Sorgfaltsregeln verstanden, die für bestimmte gefahrengeneigte Tätigkeiten die Sorgfaltsgrundsätze zusammenfassen, wobei zumeist Erfahrungsgrundsätze, die sich allgemein durchgesetzt haben, in Regelform gegossen sind. Beim Skitourengehen wäre eine solche Verhaltensnorm etwa das Mitführen des VS-Geräts sowie die Überprüfung des Funktionierens am Beginn der Tour. Beim Klettern wäre eine solche Verhaltensnorm z.B. das Verknoten der Seilenden beim Abseilen.
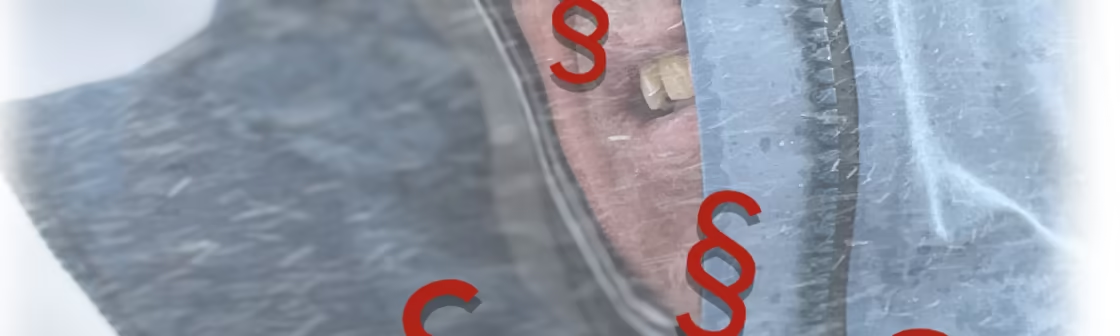
Ob ein Bergsportführer gegen eine allgemein anerkannte Verhaltensregel oder Verkehrsnorm verstoßen hat, ist eine Frage der rechtlichen Beurteilung. Ob ein gewisses Verhalten oder eine gewisse Maßnahme in der Praxis schon so weit Standard geworden ist, dass man damit von "allgemein anerkannt" sprechen kann, stellt die Schwierigkeit bei der Beurteilung dar.
Kriterien für allgemein anerkannte Verhaltensregeln oder Verkehrsnormen
Kriterien für allgemein anerkannte Verhaltensregeln oder Verkehrsnormen sind aus meiner Sicht: Verschriftlichung, Durchführung in der Aus- und Weiterbildung, Empfehlungen der Berufsverbände, Publikationen in der Alpinliteratur, ständige Verwendung in der Praxis, der Sicherheit dienend.Erst wenn eine solche Maßnahme über einen langen Zeitraum hindurch unbestritten in der Praxis anerkannt und angewandt wird und die Anordnung auch ihre Begründung hat, kann mE von einer allgemein anerkannten Verhaltensregel gesprochen werden.
Wenn bei einem tödlichen Lawinenunfall ohne Verwendung eines Verschüttetensuchgeräts der Tod des Geführten auf die Nichtverwendung zurückzuführen ist, wird seitens der Gerichte von einem subjektiv vorwerfbaren und objektiv feststehenden Sorgfaltsverstoß des Führers auszugehen sein.
Sollten jedoch keine allgemein anerkannten Verhaltensregeln vorliegen, so hat das Gericht zu überprüfen, wie sich ein mit den rechtlich geschützten Werten angemessen verbundener, besonnener und einsichtiger Mensch in der Lage des Führers verhalten hätte, um die Gefahr einer Rechtsgutbeeinträchtigung hintanzuhalten. Im Strafrecht wird diesbezüglich von der differenzierten Maßfigur gesprochen. Die Beurteilung dieser Maßfigur in der Praxis ist einer der Kernpunkte in jedem alpinrechtlichen Strafverfahren. Da das Gericht naturgemäß in den allermeisten Fällen selbst nicht alpinerfahren ist, um sich in diese Maßfigur hineinversetzen zu können, hängt es wesentlich von der Beurteilung des Alpinsachverständigen ab, wie sich diese Maßfigur hypothetisch in der konkreten Situation verhalten hat. Das Gericht muss somit mit Hilfe des Sachverständigen das Verhalten des betroffenen Führers mit dem hypothetischen Verhalten der Maßfigur vergleichen. Die Bestimmung der differenzierten Maßfigur bleibt jedoch eine Frage der rechtlichen Beurteilung.
Wie in vielen anderen Bereichen wird der Aufklärung der Teilnehmer auch im Alpinsport eine immer größere Rolle zuerkannt. In aller Regel stehen sich in der Person des «Bergführers» ein Experte, für den die strenge Sachverständigenhaftung gem. § 1299 ABGB gilt, und ein mehr oder weniger alpinistischer Laie als Geführter gegenüber. Deshalb kommt bereits der Ausschreibung einer Tour eine gewichtige Bedeutung zu. Der Hintergrund liegt darin, dass der Interessierte vor Anmeldung bzw. Antritt der Tour entscheiden kann, ob er sich auf das Unternehmen einlässt. Es liegt daher am Veranstalter, den Ablauf der Tour mit allen wesentlichen Daten möglichst genau zu beschreiben, sodann aber vor allem am >>Bergführer<<, alle notwendigen sicherheitsrelevanten Details zu erklären. Über besondere Merkmale und Schwierigkeiten der gewählten Route sind die Teilnehmer in Kenntnis zu setzen, aber auch über den Sinn von Verhaltensregeln. So ist der «Bergführer» verpflichtet, den Geführten darüber aufzuklären, warum im Aufstieg Entlastungsabstände einzuhalten sind und in der Abfahrt Hänge über 30 Grad grundsätzlich einzeln zu befahren sind.
Wenn ein Bergsteiger die Dienste eines >>Bergführer<<, in Anspruch nimmt, überträgt er seine Eigenverantwortung zum größten Teil an den Führer. Das oft zitierte und strapazierte "alpine Restrisiko" verbleibt jedoch beim Geführten. Wo die Grenze dieses Restrisikos ist, stellt das Gericht im Einzelfall vor entsprechende Probleme. Bei Lawinenunfällen mit Todes- oder Verletzungsfolgen spielt dabei die Frage der Vorhersehbarkeit die entscheidende Rolle. Sollte sich herausstellen, dass der Lawinenabgang aus der Ex-ante-Betrachtung nicht vorhersehbar war, hat sich das alpine Restrisiko verwirklicht und geht zu Lasten des Geführten.
Jedenfalls unter die Eigenverantwortung des Geführten fallen Vorfälle, auf die der Führer keinen Einfluss hat, so z.B., wenn beim Klettern ein Stein ausbricht, wenn der Geführte auf einem Weg, auf dem nicht zu sichern ist, stolpert, stürzt und sich dabei verletzt oder wenn bei einer Bergtour zB eine dem >>Bergführer<<, vorher nicht bekannte alte Verletzung des Geführten den Weitermarsch verhindert. In einem solchen Fall ist der >>Bergführer<<, aber verpflichtet, sich darum zu kümmern, dass der Geführte sicher zu Tal kommt. In der Praxis stellt dies die Führer oft vor Probleme, weil die anderen Teilnehmer die Tour fortsetzen wollen, der Führer sich aber nicht teilen kann. Er muss dann im Einzelfall entscheiden.